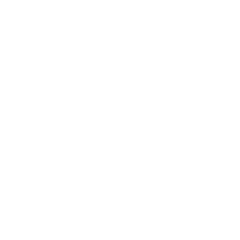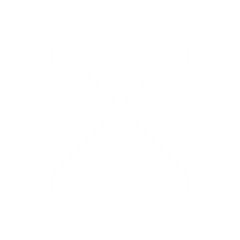Temperaturunterschiede: Einfluss auf die Aktivität der Bienen
Die Temperatur im Freien hat einen wesentlichen Einfluss auf die Aktivität der Bienen. So verhalten sich Bienen bei kalten Temperaturen ganz anders als bei warmen Temperaturen. Dabei kommt insbesondere der Temperaturregulierung im Bienenstock eine besondere Bedeutung zu. Rund 40% der Energiereserven eines Bienenvolkes werden dafür aufgewendet.
Aktivität der Bienen bei hohen Temperaturen
Im Frühling und Sommer ist die Aktivität der Bienen stark von der Temperatur im Bienenstock abhängig. Die Bienen arbeiten daran, eine konstante Temperatur zwischen 32°C und 36°C aufrechtzuerhalten. Diese Temperatur ist entscheidend für die gesunde Entwicklung ihres Nachwuchses. Bei höheren Temperaturen von bis zu 50°C können ausgewachsene Bienen gut überleben, aber extreme Hitze kann für die Larven gefährlich sein. Eine unzureichende Temperaturregulierung kann die Entwicklung der Jungbienen beeinträchtigen, insbesondere in Bezug auf ihre Lern- und Kommunikationsfähigkeiten.

Doch wie kühlen die Bienen den Bienenstock, wenn die Temperaturen im Inneren zu stark ansteigen?
Die Bienen haben effektive Strategien entwickelt, um den Bienenstock bei stark ansteigenden Temperaturen zu kühlen:
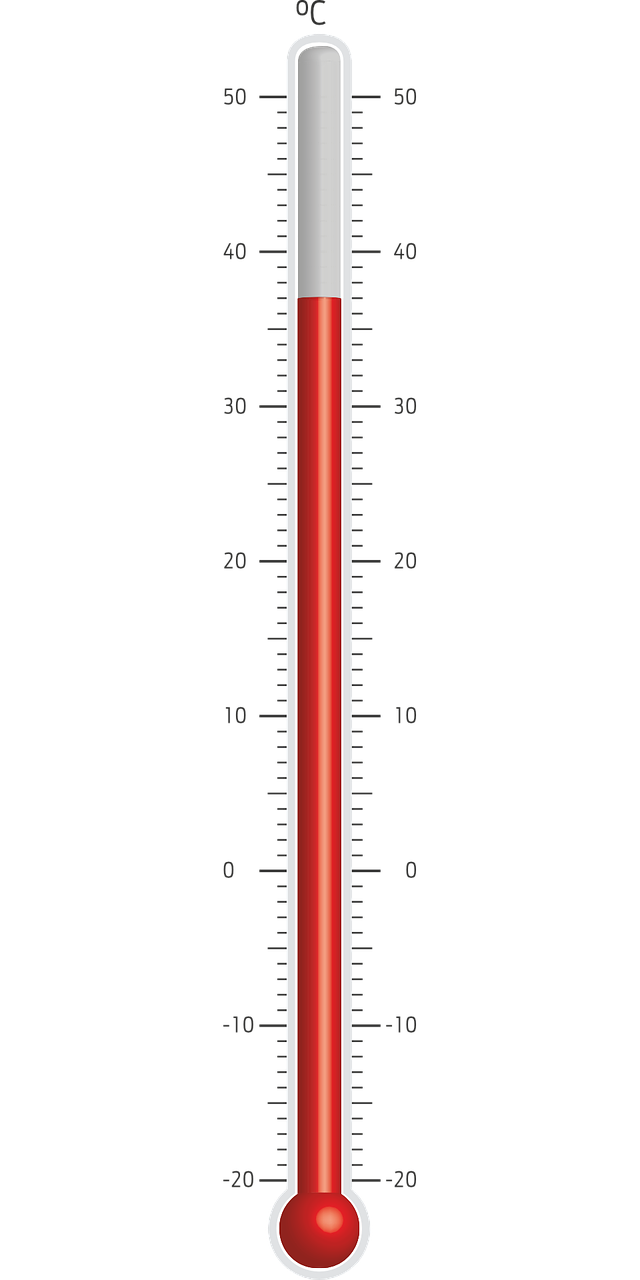
- Wasserverdunstung: Sammelbienen fliegen aus, um Wasser zu holen, das dann von den Stockbienen in kleinen Tröpfchen im Bienenstock und an den Brutwaben verteilt wird. Diese Feuchtigkeit schützt die Larven vor dem Austrocknen. Der Kühleffekt entsteht durch die Verdunstung des Wassers und hilft, die Temperatur zu senken.
- Fächern: Arbeiterinnen versammeln sich vor dem Eingang des Bienenstocks und fächern warme Luft nach draußen. Durch das Fächern mit den Flügeln entsteht ein kühlender Luftstrom. Die Bienen sind genetisch so ausgestattet, dass sie die Temperatur im Bienenstock konstant halten können, ohne ihn zu stark abzukühlen.
- Bienenbart: Wenn Wasserverdunstung und Fächern nicht ausreichen, um die Temperatur ausreichend zu regulieren, bilden die Bienen einen sogenannten Bienenbart. Bienen, die weder für die Wasserverdunstung noch für das Fächern benötigt werden, verlassen den Stock und bilden eine Traube vor dem Eingang. Diese Bienentraube erzeugt durch ihre Körperwärme einen weiteren Kühleffekt und verhindert eine weitere Temperaturerhöhung im Bienenstock. Es ist wichtig, Bienentrauben nicht zu stören, da sie eine lebenswichtige Funktion bei der Temperaturregulierung haben.
Aktivität bei niedrigen Temperaturen
Die Aktivität der Bienen bei niedrigen Temperaturen ist ein bemerkenswertes Beispiel für ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umweltbedingungen:
- Flügelschlagen zur Wärmeerzeugung:
Selbst bei niedrigen Temperaturen erfüllen die Flügel der Bienen eine wichtige Funktion. In dieser Situation nutzen die Bienen ihre Flügel, um Wärme zu erzeugen. Dies geschieht entweder, indem sie ihren Brustkorb gegen verdeckelte Brutzellen pressen oder indem sie in leeren Zellen mit ihrem Flügelschlag Wärme erzeugen.
- Bienenflug bei kälteren Temperaturen:
Bei Temperaturen unter 12°C hören die Bienen auf zu fliegen, da die Kälte ihre Flugfähigkeit einschränkt. Sinkt die Temperatur weiter auf 10°C bis 6°C, bilden die Bienen eine Wintertraube.
- Die Wintertraube:
In der Wintertraube versammeln sich die Bienen um die Bienenkönigin im Zentrum. Dort wird die Temperatur auf beeindruckende 25°C bis 30°C aufgeheizt, während die Randbereiche deutlich kühler sind (aber immer noch über 7°C bis 8°C liegen). Um sicherzustellen, dass keine Biene zu lange den niedrigeren Temperaturen ausgesetzt ist, wechseln sie regelmäßig ihre Positionen, indem sie von außen nach innen wandern.
- Auflösung der Wintertraube:
Wenn die Temperaturen wieder auf 6°C bis 10°C steigen, lösen die Bienen die Wintertraube auf und unternehmen oft einen Reinigungsausflug. Während dieses Ausflugs werden die im Darm der Bienen angesammelten Verdauungsrückstände ausgeschieden.

Bienen Gesundheit
In unserem Wissensmagazin zur Bienen Gesundheit findet ihr spannende und informative Beiträge aus der Welt unserer Lieblingsbienen.
Besucht uns auch auf
Die afrikanisierte Honigbiene – eine Killerbiene?
Von einem gescheiterten Experiment, mit dem man die Leistung der Bienen erhöhen wollte bis hin zur Züchtung einer aggressiven, angriffslustigen neuen Bienenart. Die wichtigsten Informationen zu den Killerbienen und wie diese entstanden sind!
Wespen fernhalten – Was kann ich tun?
Jeder kennt diese Situation - man sitzt friedlich im Garten, isst dabei ein Stück Kuchen oder grillt mit der Familie und plötzlich tauchen Wespen auf, die das Essen umschwirren. Für viele Menschen ist dies nicht nur störend, sondern auch nervig.